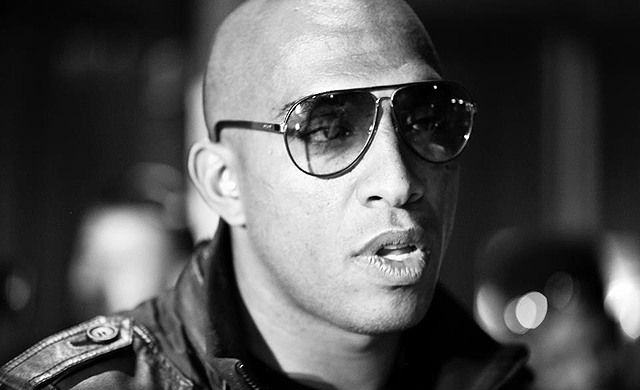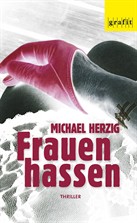Wer über den Stadt-Land-Graben nachdenkt, kommt zu verschiedenen Schlüssen. Erstens, dass man in der Stadt zwar gerne abschätzig von Landeiern spricht, dass aber in Zürich das Ländliche stehts hinter jeder Hausecke lauert. So sind mehr als zwei Drittel der in der Stadt lebenden Personen von irgendwoher zugezogen. Meistens, man darf es vermuten, vom Land. Ein Spaziergang durchs Niederdorf zeigt etwas anderes: Die Ländlerszene ist in der Stadt quicklebendig (sie wurde teilweise auch in Zürich erfunden). Und kaum hat man die Innenstadt verlassen, etwa bei der ETH Hönggerberg, trifft man auf Bauernhöfe – inklusive eines Milchautomaten. Kurz: Das Ländliche gehört zu Zürich ebenso wie die Grossstadtatmosphäre. Zweitens: In der Stadt existiert eine Vielzahl anderer Gräben, die oftmals schwerer zu überwinden sind als dieser oft und gerne zitierte Stadt-Land-Graben. Die meisten von ihnen verlaufen mitten durch die Stadt. Einige davon konnten wir ausfindig machen.
Der Offroader-Graben
Während die einen ihre chromstahlbefelgten Karossen in der Meylenstein-Waschstrassse in Tiefenbrunnen waschen lassen (und dabei in der zur Anlage gehörigen Bar Lachscracker essen), pumpen die anderen ihr Velo an den von der Stadt aufgestellten Stationen. Deren Schläuche sind oftmals so dicht wie die Strohdächer von Hütten in der Sahelzone. Manchmal begegnen sich die beiden Parteien. Und dann wird geflucht. Seite wechseln verboten! Der Offroader-Graben verläuft irgendwo an der Grenze zum Seefeld.
Der Stadt-Land-Graben
Den Stadt-Land-Graben gibt es auch in Zürich selber, er verläuft mitten durch den Juchhof, an der Grenze zu Schlieren. Auf dem gleichnamigen Fussballplatz kicken etwa Viertligavereine wie der FC Kosova, der FC Mezopotamia, CD Espanol Iberia, Centro Lusitan Zurich oder der FC Stade Marocain. Gleich nebenan, Türe an Türe, lernen junge Bauern ihr Handwerk in der einzigen Bauernschule der Stadt. Dazu gehören auch Kühe, Traktoren und ein Hofladen mit Fleisch vom Hof und Wein vom Hönggerberg. Nirgends ist Zürich zugespitzter.
Der Schlechter-Service-Graben
Während einem die Kellner in den Bars im Kreis 1 den Stuhl zurechtrücken, die Karte offen in die Hand drücken und sich entschuldigen, wenn man ihm das Getränk übers Jackett schüttet, sagt die Bedienung im Lokal im Kreis 4, nachdem man gefühlte 15 Minuten den Augenkontakt mit ihr suchte, bloss: «Ach, da hat sich noch jemand reingeschlichen. Mein Kollege kommt sicher grad.»
Der Gentrifizierungsgraben
Dieser Graben durchschneidet sämtliche Stadtquartiere. Aktuell etwa die Lagerstrasse beim Hauptbahnhof, auf deren einer Seite Leute seit Jahrzehnten mit gehörig Verkehr leben. Auf der anderen Strassenseite dagegen machen es sich Powercouples in den neuen Lofts der Europaallee gemütlich – und geniessen abends durch ihre schalldichten Fenster den Blick auf die Geleise. Natürlich trinken sie dabei ein Glas Bordeaux. Klischee ahoi! Die Lagerstrasse ist zwar nur etwa fünf Meter breit, der gefühlte Graben zwischen den neuen Nachbarn aber ist grösser als 100 Meilen.
Der Röstigraben
Auch der Blick in die Statistik hilft einem nicht, den klassischsten aller Schweizer Gräben in Zürich auszumachen. Rund 6000 Französisch sprechende Menschen stehen in Zürich einer Viertelmillion Deutsch sprechenden gegenüber. Dieser Graben hat etwa den Umfang einer Gesichtsfalte, die beim Lächeln über dieses Missverhältnis entsteht. Hier gibt es Aufholbedarf.
Der Fussballgraben
Einer der bekanntesten und wohl auch am leidenschaftlichsten gepflegten Gräben der Stadt öffnet sich zwischen GC und dem FCZ. Der Verein vom Züriberg und die Arbeiter aus dem Kreis 4. Das ist natürlich Unsinn. Die Clubs haben sich finanztechnisch längst angeglichen und spielen zudem noch im gleichen Leichtathletikstadion. Womit auch der Marsch über die Geleise bloss noch symbolischen Wert hätte – würde man ihn nicht bei jedem Derby lautstark begehen.
Hirschengraben
Der friedvollste Graben der Stadt. In ihm grasten vor 300 Jahren noch Hirsche. Heute hilft er einem unheimlich dabei, zügig vom Central zum Kunsthaus zu gelangen.
Der Gesunder-Schlaf-Graben
Während in den Quartieren oberhalb der Uni um elf Uhr abends Ruhe einkehrt und morgens um halb sieben spätestens die Wecker schellen, geht man in Aussersihl erst um 23 Uhr aus dem Haus und bleibt bis in der Früh auf der Gasse. Somit wird auch die oft beschworene 24-Stunden-Gesellschaft-Schicht nie unterbrochen.
Der Szenegraben
Die einzelnen Szenen sind in Zürich hermetisch abgeriegelt. Die Vertreter der Gothic-Szene im Niederdorf wissen wohl nicht einmal von der Bankerszene im Carlton, jene von der Off-Kunstgalerie nichts vom Ruderclub Wollishofen. Der Partygraben dagegen ist einseitig passierbar. Wer in angesagten Läden wie dem Gonzo oder der Zukunft verkehrt, würde sich nie im Leben in der Mausefalle blicken lassen. Umgekehrt? Kein Problem!
Der Velohelm-Graben
Die ehemaligen Szenemenschen haben Kinder gezeugt und die «gefährlichen Stadtkreise» in Richtung Unterstrass oder Wollishofen verlassen. Entfremdet von jeglichen Modeströmungen und gefangen in einem neuen, durch ihr Elterndasein bedingten Sicherheitsdenken, tragen sie nun knallbunte Velohelme. Dies auch beim Betreten der Bäckerei oder der Migros. Man dürfte ihn übrigens auch Babyanhänger- oder Biogemüse-in-wiederverwertbaren-Tragtaschen-Graben nennen. Aber das sind nur wieder Klischees.
Und welche Gräben kennen Sie? Und seien sie noch so klischiert.